Wir haben einen Plan gemacht...1
In und an der DDR ist nichts mit der Elle einer bürgerlich-parlamentarischen Demokratie zu messen, sondern daran, was sie laut Verfassung letztlich sein wollte: eine sozialistische Demokratie. Denn dieser qualitative Unterschied fand seinen Niederschlag in beispielsweise nicht mit der BRD vergleichbaren ökonomischen, staatlichen und gesellschaftlichen Strukturen, bestimmte die unterschiedlichen Politik- und Entwicklungsschwerpunkte und stellte auch an die Arbeitsweise der Beschäftigten des Staatsapparates auf vielen Gebieten grundverschiedene Anforderungen.
Ich selbst war niemals Mitglied einer gewählten Volksvertretung (und werde mich deshalb zu deren Arbeit auch nicht äußern), sondern jahrzehntelang Mitarbeiterin der staatlichen Organe der DDR. Die im Nachhinein über diese verbreiteten Klischees stehen im Widerspruch zu meinen Erfahrungen, obwohl ich aus manchem Erleben durchaus kritische Schlußfolgerungen ziehe. Nachstehend möchte ich einiges davon wiedergeben, ohne daß ich mich an einer umfassenden Analyse versuche.
Da mein Mann (als FDJ-Funktionär und späterer NVA-Offizier) oft den Einsatzort wechseln mußte, lernte ich in der Landesregierung Thüringen sowie in den Räten der Bezirke Leipzig, Erfurt und Dresden vor allem die mittlere Verwaltungsebene und speziell die territoriale Planung kennen.
Als ich Ende 1950 meine Tätigkeit im Umfeld des Thüringer Ministerpräsidenten Werner Eggerath aufnahm, kam ich frisch von der Universität.2 Vor dem Studium hatte ich jahrelang als FDJ-Funktionärin gearbeitet und fand das Thüringer „Präsidialklima“, wie ich es bei mir nannte, sehr gewöhnungsbedürftig. Denn da galten eine Menge ausgeklügelter Formalitäten und Vorschriften, die mir größtenteils arbeitserschwerend oder zumindest überflüssig erschienen. Ich erinnere mich meines ersten Schrecks, als man mir Ahnungslosen die Anmaßung verwies, für das Abzeichnen von Dokumenten „die Farbe“ des Ministerpräsidenten verwendet zu haben. Weitere Schocks sollten folgen. Zu allem Überfluß war mit dem papiernen Instrumentarium bürgerlicher Verwaltungsapparate auch etwas von deren Fluidum wiederbelebt worden: Ich fühlte mich auf Schritt und Tritt von einer Art weihevoller Atmosphäre umgeben (welche die gleichen Räume heute wieder erfüllen dürfte). Obwohl ich unserem Ministerpräsidenten Werner Eggerath als bewährtem Antifaschisten von vornherein große Achtung entgegenbrachte, war der verklärende Umgang mit seiner Person für mich sehr ungewohnt. Dies alles konnte doch wohl für den Regierungsapparat eines Arbeiter- und Bauernstaates nicht das Maßgebliche sein!
Das war es natürlich auch nicht, wie ich nach Verarbeitung der ersten Schockerlebnisse merkte. Manche Vorschrift erwies sich als recht nützlich, und das beklemmende Klima ging keineswegs von unserem Regierungschef aus. Im Gegenteil: Ihn lernte ich nicht nur als sehr umgänglichen Rheinländer, sondern, wie erhofft, vor allem als ehrlichen Kommunisten kennen, der im Widerstand gegen die Nazidiktatur Schlimmes erlitten hatte, die neuen Aufgaben mit großem Engagement erfüllte und seine Wurzeln in der Arbeiterklasse nicht verleugnete. Eine gewisse Eitelkeit war ihm allerdings kaum abzusprechen. Aber genährt wurde sie nur durch die von seiner Umgebung geschaffene und „verinnerlichte“ Atmosphäre.
Meine Sinne waren auch deshalb besonders geschärft, weil der Name Eggerath landauf-landab im Zusammenhang mit einer geharnischten Kritik genannt wurde, die - das müßte Anfang/Mitte 1950 gewesen sein - eine zentrale Konferenz der SED lange vor Prägung des Begriffs „Personenkult“ an ihm und anderen leitenden Funktionären wegen Duldung von Liebedienerei und ähnlichen Auswüchsen geübt hatte. Offiziell wurde im Präsidialbüro und in unserer Parteigruppe darüber nicht (oder nur nicht mehr?) gesprochen. Immerhin mischte sich in die hoheitsvolle Präsidialatmosphäre unterschwellig auch nervöse Spannung. Denn unser Chef war sich keiner Schuld bewußt und haderte noch sehr mit der öffentlichen Rüge. Aber dann kam er eines Tages freudestrahlend von einer Dienstreise zurück, rief uns zusammen und berichtete voller Genugtuung von einer Begegnung mit dem Staatspräsidenten. Mangels einsatzfähiger Fahrzeuge und ausreichender Benzinkontingente waren die Autobahnen damals kaum belebt. Aus unterschiedlichen Richtungen kommend, erkannten Wilhelm Pieck und Werner Eggerath sich deshalb an ihren PKW bereits von ferne. Man stieg aus, schüttelte sich auf dem Grünstreifen die Hände und tauschte einige freundliche Worte ... Aber dann stellte unser Chef jene Frage, die jedem treuen Parteiarbeiter an seiner Stelle ebenfalls auf der Seele gebrannt hätte: Wieso ich? Und Wilhelm Pieck antwortete darauf sinngemäß: Uns erschien es notwendig. Aber gräme dich deshalb nicht, Werner. Irgend jemand mußten wir doch nehmen ... Ich gönnte unserem Genossen Eggerath die ungeheure Erleichterung, obwohl mich der allgemein entspannte „Übergang zur Tagesordnung“ - und zwar ein- für allemal - dann doch überraschte. Aber ich war die Jüngste, Unerfahrenste und zudem eigentlich sehr schüchtern.
Dennoch konnte ich in meiner ersten Thüringer Zeit sehr viel lernen und sogar manche bis dahin mitgeschleppte eigene Engstirnigkeit überwinden. Das betraf vor allem den selbstverständlichen Umgang und die achtungs-, meist aber sogar vertrauensvolle Zusammenarbeit mit „bürgerlichen“ Politikern, Wissenschaftlern, Künstlern und „Kirchenleuten“, deren es im Lande eine Menge gab. Erstaunt und anfangs unter innerem Protest empfing ich außerdem z. B. Aufträge zur freundlichen Korrespondenz und praktischen Hilfeleistung für eine alte Fürstin, die frierend in ihrem ehemaligen Sondershäuser Feudalschloß saß und von Werner Eggerath, so weit ich mich erinnere, nicht nur einmal besucht wurde.
Wie auf allen anderen Ländern der DDR lasteten auch auf Thüringen nicht nur die unmittelbaren Folgen des Hitlerkrieges und der fortschreitenden Spaltung Deutschlands, sondern zudem das schlimme Erbe einer besonders in den ländlichen Gebieten seit vielen Jahrzehnten gröblichst vernachlässigten Volksbildungs-, Kultur-, Gesundheits-, Sozial-, Jugend- und Sportpolitik. Ich war im Eggerathschen Büro für diese Aufgabenbereiche zuständig und erinnere mich haarsträubender Bestandsaufnahmen, die danach offen in der Regierung oder im Landtag behandelt wurden. Einen maßgeblich durch mich formulierten Landtagsbericht zur Situation der Volksbildung fand ich noch Ende der achtziger Jahre im Archiv. Man sollte ihn erneut hervorholen, um wenigstens annähernd zu begreifen, welche ungeheuren Leistungen die DDR auf diesem Gebiet vollbracht hat.
Wie in allen neuen Bundesländern, wird gegenwärtig auch in Thüringen über die Existenzchancen der zahlreichen Theater und Orchester - in der Mehrheit aus vormals höfischen Ensembles hervorgegangen - viel orakelt. Traditionsreiche Stätten, die von der „armen“ DDR über Jahrzehnte nicht nur am Leben erhalten, sondern gefördert wurden und eine zuvor nie gekannte kulturelle Breitenwirkung erreichten, werden durch die reiche Bundesrepublik nun rigoros in ihren Möglichkeiten beschnitten, einigen wird sogar das Lebenslicht ausgeblasen. Und da Kultur sich heutzutage „rechnen“ muß, wird sie für den Durchschnittsbürger wieder zum unerschwinglichen Luxus.
Dazu fällt mir folgende Episode ein: Damals ging es um die Verteilung der überaus knappen Landesmittel - es müßte für das Haushaltjahr 1952 gewesen sein. Selbstverständlich forderten „meine“ Fachministerien und -abteilungen mit gutem Grund schlichtweg utopische Summen für die Lösung der dringendsten Probleme und waren nur schwer zur Reduzierung dieser Vorstellungen zu bewegen. Bei der Kultur klaffte die Schere zwischen Anspruch und Möglichkeit besonders weit auseinander. Allein schon die notwendigen Zuschüsse zur Aufrechterhaltung der Theater und Orchester waren enorm, denn eine Erhöhung der für jeden Bürger erschwinglichen Eintrittspreise stand nicht zur Debatte. Das Kultusministerium sah keinen Ausweg. Und da sollte ausgerechnet ich dem Ministerpräsidenten Lösungsvorschläge anbieten! Nachdem ich mich zum wiederholten Mal ergebnislos vor allem mit den ebenso zahlreichen wie kostspieligen Stellenplänen befaßt hatte, kam mir eine frevlerische Idee, für die ich noch nachträglich Abbitte leiste. Als gebürtige und in Theaterdingen etwas arrogante Dresdnerin stellte ich an meinem Thüringer Regierungsschreibtisch nämlich folgende Überlegung an: Welches künstlerische Niveau würden solche kleine Musentempel denn schon aufweisen - dieses abgelegene Meininger Theater beispielsweise, jenes in Eisenach oder ein sogenanntes Loh-Orchester Sondershausen? Da konnten ein paar Schließungen wohl kaum schaden. Kurzum, ich trabte erleichtert mit eigenständigen Berechnungen zu meinem obersten Chef und schlug ihm einiges in der Art vor. Seine nachfolgende Lektion über die Pflicht des Arbeiter-und-Bauern-Staates zur Wahrung des nationalen Kulturerbes und zur Befriedigung der kulturellen Bedürfnisse aller Bürger klingt mir heute noch in den Ohren. Das Ende vom Lied war, daß der Kommunist Werner Eggerath in einer der schwierigsten Haushaltsituationen des Landes nach vielem Hin und Her die notwendigen Finanzmittel doch noch in einem anderen Bereich freisetzte und die Thüringer Kultureinrichtungen in vollem Umfang absicherte.
Mir war das natürlich eine Lehre, aber eigentlich lernten wir alle täglich dazu. Denn viele Aufgaben waren völlig neu oder mußten auf eine andere als die herkömmliche Art gelöst werden. D. h. im Unterschied zu bürgerlichen Verwaltungsapparaten konnte es uns nicht genügen, jeden Vorgang aktentechnisch „sauber“ zu erledigen, sondern wir hatten mit innerem Engagement das Bestmögliche für die Menschen zu tun. Dies betraf u. a. die schriftlich oder mündlich vorgebrachten Hinweise, Bitten und Beschwerden von Thüringer Bürgern, Betrieben und Einrichtungen, von denen auch ich allerhand abbekam. Eine leichte Aufgabe war das nicht, denn selbstverständlich ging es damals vor allem um Wohnraum, Heizmaterial, fehlende Investitionen, mangelnde Rohstoffe und andere materielle Probleme. Jeder von uns war zwar hochmotiviert, verfügte aber über keinerlei Sonderfonds und durfte natürlich gegenüber den verantwortlichen Organen nur in sehr schwerwiegenden Fällen mit der Autorität des Ministerpräsidenten operieren.
Selbst immaterielle Probleme waren manchmal nicht lösbar. Unvergeßlich ist mir ein Fall, in den ich völlig erfolglos allerhand persönliche Anteilnahme, Arbeitszeit und dienstliche Aktivitäten investierte: Eines Tages stand vor meinem Schreibtisch ein abgerissener, hohlwangiger alter Mann. Er hatte zum Ministerpräsidenten gewollt, war im Vorzimmer zu mir geschickt worden, stellte sich nun als bekannter Komponist, ehemaliger Orchesterleiter, Musikdirektor etc. vor und beklagte sich bitter, daß ihm im Land Thüringen trotz wiederholter Anrufung der zuständigen Instanzen bislang keine angemessene künstlerische Aufgabe angeboten worden sei. Der Name des Herrn K. war mir aus der Musikwelt zwar kein Begriff, aber seine ganze Art ließ mich trotz des „abgebrannten“ Äußeren irgendwie doch auf einen Künstler schließen. Ich wollte der Sache also auf den Grund gehen und mich nach Möglichkeit seiner annehmen. Der beste Ausgangspunkt wären seine kompositorischen Werke gewesen, aber angeblich hatte er sämtliche Partituren im Krieg verloren. Nach seiner Darstellung war er von den Nazis in einer größeren Stadt Polens (er nannte wohl Krakau) als Theaterintendant und Musikdirektor eingesetzt worden und wollte das u. a. dazu genutzt haben, sozusagen unter den Augen der Gestapo die polnische Nationaloper „Halka“ zu inszenieren. Detailliert schilderte er die triumphale Begeisterung des polnischen Premierenpublikums, die Bestürzung der faschistischen Besatzer, das nachfolgende Aufführungsverbot und gefährliche Schikanen ihm gegenüber. Allerdings konnte er seine Geschichte nicht beweisen und wußte, daß sie von mir nicht zu überprüfen war. Zumindest auf unserer Ebene existierten keine Informationskontakte nach Polen. Sie wären seinem Anliegen auch kaum von Nutzen gewesen. Vielleicht hätte sich seine materielle Lage nach Bestätigung der Angaben etwas verbessern lassen. Aber er wollte kein Almosen, sondern eine würdige künstlerische Aufgabe. Es dauerte Wochen, erforderte allerhand Telefonate, Rücksprachen, Briefwechsel und den wiederholten Empfang von Herrn K. in meinem Dienstzimmer, bis ich mir einigermaßen ein Bild über seine Fähigkeiten und Aussichten machen konnte: Die wichtigsten Thüringer Musikwissenschaftler kannten ihn nicht; das Archiv des Senders Leipzig teilte mit, daß von ihm nur zwei völlig unbedeutende Stücke Unterhaltungsmusik vorhanden seien; und ein Musikexperte beurteilte das exklusiv für mich geschriebene Liedchen ähnlich abfällig. Schwerer noch wog für mich allerdings, was ich inzwischen selbst erkannte: Der alte Mann litt nicht nur an krankhafter Selbstüberschätzung, sondern war mit seinen Kräften am Ende. Allenfalls hatte er zum beiderseitigen Nutzen bei der künstlerischen Leitung eines unserer Volkskunstensembles mithelfen können. Doch das war ihm zu gering. Ich brachte es trotzdem nicht fertig, ihm einfach den Stuhl vor die Tür zu setzen und versuchte wenigstens zuzuhören, aufzumuntern. Eines Tages verehrte er mir einen selbstgeschriebenen Walzer des Inhalts, wie eine junge Staatsfunktionärin dem verkannten Genie endlich zu neuen Ehren verhilft. Irgendwann blieb er dann weg. Ich war mehr erleichtert als beunruhigt und erkundigte mich nicht nach ihm. Später bekam ich deshalb ein schlechtes Gewissen.
Damit beschäftigt, in die letzten Geheimnisse der ebenso komplizierten wie umfangreichen Thüringer Verwaltungsstruktur einzudringen, machte ich mir über deren Veränderung keine Gedanken. Sie schien für Ewigkeiten gegründet, obwohl mit mehr als dreißig Kreisen bzw. kreisfreien Städten schwer zu hantieren war. Als ab dem Sommer 1952 die Bildung von Bezirken vorbereitet wurde, bedauerte ich das vorwiegend. Aus dem herrlichen, großen Land Thüringen würden die kleinen Bezirke Erfurt, Gera und Suhl hervorgehen, und die meisten Mitarbeiter - vom Ministerpräsidenten bis zum Archivar - sich von manchem bisherigen Kollegen, dem gewohnten Aufgabengebiet oder sogar dem Arbeitsort verabschieden. Dies alles blieb auch mir nicht erspart, denn ich folgte meinem Mann an seine neuen Einsatzorte außerhalb Thüringens und übte dort andere Tätigkeiten aus.
In den Staatsapparat kehrte ich Ende 1953 als Mitarbeiterin der Bezirksplankommission beim Rat des Bezirkes Leipzig zurück. Die Verwaltungsreform war vor allem mit den besseren Möglichkeiten zur Leitung der Volkswirtschaft sowie zur Entwicklung von Demokratie und Bürgernähe begründet worden. Nun staunte ich über die während eines Jahres erreichten Fortschritte. Alles schien übersichtlicher, flexibler -moderner. Aber am meisten überzeugte mich die Bezirksplankommission. Sie war das wichtigste Instrument des Rates, die „Drehscheibe“ der Planung für alle übrigen Ratsbereiche sowie für die komplexe Entwicklung des Bezirkes und genoß bereits hohes Ansehen. Unser Leiter war um die Dreißig, sein Stellvertreter und die meisten Mitarbeiter noch jünger und trotzdem bereits recht qualifiziert. Die Zusammenarbeit verlief allseitig unkompliziert, und selbst während höchster Belastungen herrschte in unserer kleinen, engagierten Truppe viel Heiterkeit - ein kaum zu überschätzendes Verdienst des genannten Stellvertreters. Obwohl ich nach kurzer Zeit die gleichen Fachbereiche wie im Thüringer Präsidialbüro betreute, war es für mich ein großer Schritt vorwärts: Ich hatte wesentlich mehr eigene Verantwortung und Bewegungsfreiheit, konnte selbständiger sowie basisnäher arbeiten und erlebte auch meine ersten „Planabstimmungen“ in der Staatlichen Plankommission Berlin. Im Gegensatz zu heutigen Darstellungen handelte es sich dabei bereits damals keineswegs um „Befehlsempfänge“, sondern es fanden oft recht kämpferische Auseinandersetzungen über die Entwicklung der Bereiche und Territorien statt.
Die Investitionskennziffer war für das jeweilige Fachorgan zwar nur eine von vielen, aber stets die am heißesten umstrittene. Der größte und heikelste „Brocken“ in meinen Bereichen war der Neubau des Leipziger Opernhauses. Bereits während der Vorbereitung türmten sich scheinbar unüberwindliche Schwierigkeiten auf, von denen die Beschaffung komplizierter Bühnentechnik aus dem NSW nicht die kleinste war. (Soweit ich mich erinnere, spielten dabei auch Embargobestimmungen der BRD gegen die DDR eine ungute Rolle.) Welche immense Nervenkraft besonders unsere parteilose Kollegin „Investkoordinatorin" für dieses Vorhaben eingesetzt hat, würde ein lebenslanges kostenloses Abonnement rechtfertigen. Ihre Kenntnis der Materie, verbunden mit Energie, Zähigkeit und Geduld schienen mir auch sonst bewundernswert. Sie war die Stütze des Vorsitzenden der Bezirksplankommission und genoß allergrößten Respekt. Ich habe viel von ihr gelernt.
Zum ersten Mal erlebte ich auch selbst die bereits länger praktizierte Einbeziehung der Bevölkerung in die Vorbereitung von Investitionen, z. B. beim Bau von Schulen, Kinder- und Kultureinrichtungen. Die dazu vor allem in den Gemeinden durchgeführten Aussprachen und Versammlungen waren stets sehr gut besucht. Oft verpflichteten sich die Anwesenden zur tatkräftigen Unterstützung der Baumaßnahme. Und stets wurden ihre kritischen Hinweise sowohl von den Projektanten als auch den staatlichen Organen sehr ernst genommen.
Bei der Vorbereitung des Volkswirtschaftsplanes 1955 stand ich vor einer ähnlichen Situation wie Jahre zuvor: Die Investitionsanforderungen überstiegen die Möglichkeiten, und einer „meiner“ Bereiche kam allein nicht zurecht. Diesmal war es das Gesundheits- und Sozialwesen, und eine „Eggerathsche Lösung“ leider nicht in Sicht. Es ging vor allem um die zentral- und bezirksgeleiteten3 Einrichtungen. Ich hatte mir den Einstieg der Ständigen Kommission Gesundheitswesen des Bezirkstages in diese schwierige Problematik gewünscht. Aber deren Arbeitsplan war durch uns nicht beeinflußbar. Wir hatten ihre Hinweise und Aufträge zu empfangen, und nicht umgekehrt. Also fand ich mit meinen Partnern in den Fachabteilungen eine andere halbwegs „demokratische“ Lösung: Wir vereinten die wichtigsten antragstellenden Einrichtungen in Gestalt kompetenter Vertreter zu einer eigenen „Kommission“ und besichtigten wechselseitig sämtliche in Frage kommenden Objekte, um danach eine Dringlichkeitsliste zu erarbeiten. Das ging nicht reibungslos ab, aber am Ende entstand daraus doch eine vernünftige Empfehlung für die Beschlußfassung im Bezirkstag.
Einmal - es war Mitte der fünfziger
Jahre - demonstrierte der Rat des Bezirkes Leipzig eine spezielle Art von
Volksverbundenheit: Wohl auf der Suche nach neuen kulturellen Höhepunkten war
von irgendwem die Organisierung eines großen Karnevalumzugs angeregt und danach
in den zuständigen Gremien beschlossen worden. Anfangs rief das bei uns nur
Kopfschütteln hervor, zumal der Rat des Bezirkes den Zug anführen sollte. Aber
als wir uns dieser lockeren Sache diszipliniert näherten, fingen wir Feuer.
Schließlich setzte unser stellvertretender Vorsitzender - wie gesagt, ein
herrlicher Spaßvogel - alle Mitarbeiter der Bezirksplankommission als
Schulklasse auf eine rollende Plattform und postierte sich selbst als Lehrer
davor. Die Wagen des Rates des Bezirkes waren als solche gekennzeichnet, und die
Massen am Straßenrand applaudierten ihnen mindestens ebenso freudig wie jedem
der übrigen zahlreichen Fahrzeuge oder Fußgänger. Kritische Politsatire, fällt
mir heute natürlich auf, habe ich im Zug nicht bemerkt. Möglicherweise
getraute sich niemand, oder freundliche Helfer hatten etwas aussortiert. Aber
vielleicht war auch keine große Resonanz zu erwarten. Denn im Rückblick
erscheinen mir jene Leipziger Jahre noch oder wieder - das Jahr 1953 lag ja erst
knapp hinter uns - relativ entspannt. Andere mögen das anders erlebt haben.
Aber was für ein allgemeiner Jubel, als die Stadt einmal Etappenort der
Friedensfahrt wurde! Danach war wirklich ganz Leipzig auf den Beinen, um das
internationale Peloton zu empfangen, doch vor allem, um „Täve“ und seine
Truppe mit ungeheuren Begeisterungsstürmen zu Höchstleistungen anzufeuern! Aus
dieser Zeit erinnere ich mich auch einer Wahl, die in unserem „ganz
normalen“ Wohnbezirk fast wie ein Volksfest ablief. Ich brachte die schönsten
Blumen meines Kleingartens ins Wahllokal, war danach mit der fliegenden Urne bei
den Alten und Kranken unterwegs und traf überall auf freundliche Gesichter.
Abends wurden dann - unter Vorzeigen und Begutachten jedes „zweifelhaften“
Wahlzettels - vor allerhand Neugierigen die Stimmen öffentlich ausgezählt, und
ich durfte die stolzen Prozentzahlen ausrechnen.
 Quelle
Bildarchiv d Mark Allgem.
Quelle
Bildarchiv d Mark Allgem.
Die Friedensfahrt fand alljährlich Millionen begeisterter Zuschauer in Polen, der CSSR und der DDR
Die nächste Etappen unserer familiären Lehr- und Wanderjahre führten über Dresden wieder nach Erfurt, wo ich - nach langer Krankheitspause - ebenfalls in der Bezirksplankommission arbeitete. Als Hilfskraft des Investitionsverantwortlichen - eine andere Planstelle war nicht frei - buk ich nun zwar persönlich „kleinere Brötchen“, kam dafür aber in ein faszinierendes Aufgabengebiet. Zwischenzeitlich hatte es in den Bezirken und der gesamten Volkswirtschaft zwar einige strukturelle Veränderungen gegeben4, aber insgesamt schien alles konsolidiert, noch seriöser und stabiler zu sein. Auffällig war das deutlich gewachsene Selbstbewußtsein der Ständigen Kommissionen, sowie der Räte der Kreise und der Vorsitzenden der Kreis- und Stadtplankommissionen, von denen die meisten nicht älter waren als ich. Da ich zu dieser Zeit bereits drei Kinder hatte, waren meiner Beweglichkeit Grenzen gesetzt. Aber daß sich der Bezirk Erfurt seit 1952 tatsächlich „gemausert“ hatte, merkte ich auch ohne längere Dienstreisen. Faszinierend fand ich vor allem die bereits spürbare, noch mehr aber die geplante Entwicklung des früher als „Armenhaus“ bekannten Eichsfeldes. Auch die ersten Landwirtschaftlichen Produktionsgenossenschaften hatten sich gefestigt. Nun galt es, die Masse der Einzelbauern durch Überzeugungsarbeit für die LPG zu gewinnen, um auf diese Weise die Voraussetzungen für einen erheblichen Produktivitätsschub in der Landwirtschaft und eine noch bessere Versorgung der Bevölkerung zu schaffen. Die meisten Mitarbeiter der Bezirksplankommission beteiligten sich über mehrere Wochen an den dazu organisierten „Agitationseinsätzen“, während die gesundheitlich oder - wie ich - familiär Behinderten den Dienstbetrieb aufrechterhielten. Die Kollegen berichteten danach nicht nur von erfreulichen Erlebnissen, aber insgesamt ging es während dieser Tage doch einen großen Schritt voran.
Den nächsten wichtigen Sonderauftrag konnte ich mit meinem familiären Pflichten in Einklang bringen und absolvierte einen vierwöchigen Einsatz im Schuhkombinat „Paul Schäfer“ Erfurt. Die Methode, Staatsangestellte und andere Funktionäre regelmäßig in der Produktion arbeiten zu lassen, stammte, hörten wir, aus China. So begann mein Tagewerk bereits morgens sechs Uhr, und ich hatte, am Band stehend, Brandsohlen zu produzieren. Nach drei Wochen war ich froh, mich sitzend vor einem Haufen verpfuschter Schuhe wiederzufinden, die ich in ihre ursprünglichen Bestandteile zerlegen mußte. Am dritten Morgen war der trotz meines Fleißes nachwachsende Berg allerdings spurlos verschwunden, denn selbigen Tages erhielt der Betrieb irgendwelchen hohen Besuch. Für mich hieß das leider: abschließend nochmals drei Frühschichten bei den Brandsohlen! Wegen meiner chronischen Müdigkeit blieben die uns aufgetragenen Kontakte mit „den Werktätigen“ für meine Person mäßig, und geniale Einfälle zur Verbesserung der Arbeitsorganisation wollten mir auch nicht kommen. (Ich habe es stets gehaßt, mich mit ungenauer Sachkenntnis in die Verantwortung anderer einzumischen.) Dagegen hatte ich nach diesen Wochen durchaus einiges dazugelernt. Eine Genugtuung war es auch, daß sich anfangs selbst einige Ratsmitglieder und Abteilungsleiter diesen kontinuierlich organisierten Einsätzen stellten. Später wurden zuerst sie „unabkömmlich“, und nach einiger Zeit war auch gegenüber dem „Fußvolk“ von Arbeit in der Produktion nicht mehr die Rede. Die chinesischen Methoden waren sozusagen aus der Mode, obwohl das Problem auch weiterhin stand: die Lebens- und Basisnähe der staatlichen Mitarbeiter. Die meisten von uns - und natürlich auch ich - waren zwar bereits über Jahre in Elternvertretungen, Wohngebieten oder Massenorganisationen gesellschaftlich aktiv, schwebten also keineswegs „über den Dingen“ und tauschten persönlich oder in Partei- und Gewerkschaftsversammlungen Erfahrungen aus. Aber die entscheidenden Schwerpunkte lagen in der Wirtschaft. Was dort aus objektiven oder subjektiven Gründen nicht funktionierte, schadete allen übrigen Bereichen und letztendlich der Bevölkerung.
Deshalb verpflichtete auch ich mich in meiner nächsten Dienststelle - der Bezirksplankommission meiner Heimatstadt Dresden -, neben meinem eigentlichen Arbeitsgebiet einen „Patenbetrieb“ bescheidener Größe zu betreuen. Dieser lag in Freital bei Dresden, hatte vordem fast ausschließlich Weinfässer aus edlem Eichenholz hergestellt und schlug sich nun mit vielen Problemen herum. Die traditionelle Produktion hätte sogar Exportchancen gehabt. Aber die Rohstoffprobleme waren kaum zu lösen -offenbar wuchsen alte Edeleichen überall, nur nicht in der DDR. Eine Ersatzproduktion von Fenstern und Massenbedarfsartikeln aus Holz bereitete nicht nur technologische Schwierigkeiten, sondern erforderte auch neue Ausrüstungen. Das „A und O“ waren die Beschaffung und der Einbau moderner Trockenkammern.
Ich konnte das bei späteren Einsätzen dieser Art immer wieder erleben: Zunächst wurde ich mit Skepsis empfangen. An Aufpassern und Besserwissern, die den überlasteten Betriebsfunktionären die Zeit stahlen oder an die laufenden Maschinen gingen, um den Arbeitern komische Fragen zu stellen bzw. mal kurz die hohe Politik zu erläutern, war keiner interessiert. Aber sobald klar wurde, daß ich die betrieblichen Probleme wirklich kennenlernen und bei ihrer Lösung mithelfen wollte, öffneten sich Türen und Herzen. Gelernt habe ich auch in Freital allerhand (und nicht nur, daß man jeden echten Tischler an den fehlenden Fingerkuppen erkennt). Inwieweit meine Patenschaft dem Betrieb wirklich nutzte, bleibt offen, obwohl ich das dienstliche Briefpapier und meine Vorgesetzten dafür des öfteren strapazierte. Auf jeden Fall aber identifizierte ich mich zunehmend mit „meinem“ Betrieb, und wahrscheinlich schmolz auch für seine Beschäftigten die Entfernung zum Rat des Bezirkes. Als man mich bat, die monatliche Gewerkschaftsschulung in der Abteilung Fensterproduktion zu übernehmen, wertete ich das als Vertrauensbeweis und fand danach stets interessierte Gesprächspartner.
Meine eigentlichen Aufgaben lagen auf dem Gebiet der Perspektivplanung. Ich hatte in Zusammenarbeit mit allen zuständigen Organen die Standortgenehmigungen für jene Investitionsmaßnahmen vorzubereiten, die nicht in die Zuständigkeit der Räte der Kreise und Städte fielen. Dies betraf außer Vorhaben mit großem Wertumfang vor allem solche, die besondere Anforderungen an territoriale Ressourcen (z. B. Arbeitskräfte) stellten oder mehrere Kreise tangierten. Die örtlichen Organe bis hinab zu den Räten der Gemeinde wurden in die Prüfung der Objekte einbezogen, und die wichtigsten Maßnahmen vom Rat des Bezirkes bzw. vom Bezirkstag beschlossen.
Besonders das Elbtal zwischen Riesa und Dresden bildete nicht nur ein hochindustrialisiertes, sondern in jeder Beziehung hochsensibles Gebiet, in das trotzdem noch mancher und manches hineindrängte. Einiges wurde bereits durch die Staatliche Plankommission abschlägig beschieden, aber das meiste erhielten wir zur Prüfung und mußten uns mit den Antragstellern, z. B. Industrieministerien, auseinandersetzen. Mir ist nicht erinnerlich, daß den Räten der Bezirke (denn das trifft auf meine spätere Tätigkeit in Erfurt ebenso zu) von zentraler Seite Vorhaben aufgezwungen wurden, gegen die sie begründete Einsprüche geltend machten. Anhand der Standortunterlagen ist sicher auch noch nachweisbar, daß die Probleme des Umweltschutzes keineswegs eine untergeordnete Rolle spielten. Denn es existierten Gesetze, nach denen z. B. der Bezirkshygieneinspektion, der Wasserwirtschaftsdirektion sowie den Wasserversorgungs- und Abwasserbetrieben das Recht auf Einsprüche und Auflagen zustand. Inwieweit die gesetzlichen Festlegungen den Erfordernissen entsprachen, müssen Experten beurteilen. Aber, daß sie von den genannten Stellen zumindest bei Neubauten - auch gegenüber dem Wunschdenken zentraler oder bezirklicher Organe - in der Regel konsequent gehandhabt wurden, kann ich guten Gewissens versichern. Schließlich hatte ich damit genügend Sorgen. Allerdings ließ die Einhaltung der getroffenen Festlegungen bzw. die Durchsetzung wirksamer Sanktionen manchmal zu wünschen übrig.
Obwohl ich auch für die Standortvorbereitung des Dresdner Fernsehturms auf den Elbhügeln nahe Pappritz mitverantwortlich zeichnete, fesselten mich vor allem die industriellen Vorhaben. Beispielsweise war das Riesaer Rohrwalzwerk bereits am Schreibtisch eine phantastische Angelegenheit. Aber den eigentlichen Höhepunkt bildeten die Begehungen und umfangreichen Standortberatungen vor Ort. Es faszinierte mich, auf diese Weise nicht nur in die Zukunft blicken, sondern sie auch sichtbar mitgestalten zu können.
Ich liebte meinen Beruf und bin noch heute stolz auf ihn, obwohl mit der DDR auch ihre Planungsorgane generell in Mißkredit gerieten. Leider waren einige der Betriebe, für deren weitere Entwicklung auch ich mich damals engagierte, nach 1989 von der unverantwortlichen Verschleuderung unserer volkswirtschaftlichen Werte, von Betriebsstillegungen, Massenentlassungen und Abrissen betroffen.
Anschließend
an meine Dresdner Zeit, d. h. nach einem erneuten Umzug, arbeitete ich mehrere
Jahre als Zivilbeschäftigte der Nationalen Volksarmee. Da unsere Familie später
wieder nach Erfurt verschlagen wurde, kehrte ich jedoch erneut in die dortige
Bezirksplankommission zurück und durfte die letzten 17 Jahre meines
Arbeitsiebens zusammenhängend absolvieren.

Dresden 1945: Nach den anglo-amerikanischen Luftangriffen waren auf 15 Quadratkilometern 17 Millionen Kubikmeter Schutt und Trümmer zurückgeblieben
 Aus
Dresden VEB Deutscher Verlag der Wissenschaften, Berlin 1984
Aus
Dresden VEB Deutscher Verlag der Wissenschaften, Berlin 1984
Unter aktiver Mitwirkung der Bevölkerung wurden überall in der DDR bereits in den ersten schweren Nachkriegsjahren nicht nur Betriebe und Wohnungen instandgesetzt oder neu gebaut, sondern auch zahlreiche kulturhistorische Bauten originalgetreu wiederhergestellt Foto Kronentor des Dresdner Zwingers mit Wallgraben
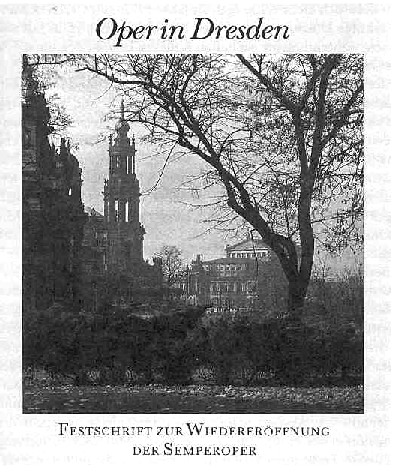
Am 13 Februar 1985, dem 40 Jahrestag der Zerstörung Dresdens, öffnete die traditionsreiche Dresdner Semperoper mit einer Aufführung von Webers „Freischütz“ wieder ihre Pforten für viele Tausende Musikfreunde aus der DDR, der BRD und aus aller Welt.
An dieser Stelle erlaube ich mir einige weitergehende Bemerkungen: Weder damals noch später haderte ich mit dem (durch die häufigen Umzüge sowie Gesundheits- und Familienprobleme) verursachten Auf und Ab meiner beruflichen Laufbahn. Ich versuchte, jede Aufgabe - ob „hoch“ oder „niedrig“ - nach besten Kräften zu erfüllen. Auch wenn ich nie herausragende Funktionen bekleidete (erst einige Jahre vor dem Rentenalter brachte ich es zur Sektorenleiterin), fühlte ich mich stets meinen Kenntnissen und Fähigkeiten entsprechend gefordert und blicke gern auf mein erfülltes Berufsleben zurück. Dessen aus feministischer Sicht scheinbar negative Seite - die Abhängigkeit von den Zufälligkeiten der beruflichen Entwicklung des Ehemannes und den Verpflichtungen einer kinderreichen Mutter - wurde vom Positivum der gesellschaftlichen Verhältnisse in der DDR bei weitem aufgewogen. Denn jederzeit durften meine Familie und ich nicht nur die sozialen Errungenschaften der DDR nutzen - stellvertretend für alle seien hier nur die Gesundheits- und Kinderbetreuung genannt -, sondern mir wurde der Abschluß eines Fernstudiums ermöglicht, und überall war mir eine interessante Arbeitsstelle sicher (ein zweijähriges Intermezzo als maschineschreibende Heimarbeiterin war ein freiwilliger Tribut an die Gesundheit meiner Kinder). Aber vor allem: Ich konnte stets auf die Hilfe und das Verständnis meiner Vorgesetzten und Kollegen bauen. Unter den heutigen, d. h. BRD-Bedingungen hätte ich sicher mein ganzes Leben als Hausfrau verbringen müssen.
Trotzdem war es mir natürlich nicht völlig egal, im Jahre 1972 - als vierfache Mutter und nach meinem zehnten Umzug - zum dritten Mal im gleichen Haus fast von vorn anfangen zu müssen, während meine seßhaften Kollegen bzw. Kolleginnen X, Y und Z inzwischen nicht nur eine Stufe nach oben gelangt waren.
Die Vorbereitung jedes Volkswirtschaftsplanes war mit einem Aufwand verbunden, der nicht nur uns Mitarbeiter der Bezirksplankommission wochen- und monatelang in Atem hielt. Denn bis zu jedem Betrieb, jeder Gemeinde und den letzten Einrichtungen hin war die von den wirtschaftsleitenden Organen herausgegebene „Staatliche Aufgabe“ zu prüfen und in allen möglichen Gremien, nicht zuletzt aber mit den Werktätigen, zu beraten, bevor die vielfach veränderten Planvorschläge den Rücklauf antraten und nach erneuten Abstimmungen in und zwischen allen Ebenen in Gestalt „Staatlicher Planauflagen“ Verbindlichkeit erlangten. Es gab also sehr viele Möglichkeiten der demokratischen Mitbestimmung. Allerdings wurden sie vor allem an der Basis nicht genügend genutzt.
Bei den Kreis- bzw. Bezirksplankommissionen flossen sämtliche Bilanzen, Entwicklungsplanungen und Anforderungen für das Territorium zusammen. Der Vorsitzende der Bezirksplankommission trug die Eckpunkte des Planentwurfs sogar den Vorständen der Massenorganisationen (FDGB, DFD usw.) gesondert vor und empfing deren Hinweise. Höhepunkt der Vorbereitungen war dann die in jedem Bezirk stattfindende „Komplexberatung“ des Vorsitzenden oder eines Stellvertretenden Vorsitzenden der Staatlichen Plankommission, an der auch Industrieminister oder sonstige kompetente Vertreter zentraler Organe teilnahmen. Ich habe mehrere dieser Zusammenkünfte mit vorbereitet und erlebt. Bereits Wochen zuvor wurde unsere kleine Truppe in der Staatlichen Plankommission erwartet, um mit den zentralen Mitarbeitern tagelang den Entwurf der detaillierten Festlegungen zu formulieren. Manche hielten der unmittelbaren Auseinandersetzung dann nicht stand, wurden während der Komplexberatung aus dem Stegreif neu gefaßt und mußten trotzdem zum Abschluß allesamt stilistisch einwandfrei und unterschriftsfertig in mehreren Exemplaren vorliegen. Das war schon jedes Mal eine Nervenschlacht!
Ähnliche Veranstaltungen, allerdings unter Leitung von Mitgliedern des Rates des Bezirkes, hatten jeweils Wochen früher bei den Räten der Kreise und Städte stattgefunden. Auch die Protokollentwurfe für diese „Planberatungen“ wurden zuvor in gemeinsamer Abstimmung unter Federführung des sogenannten „Kreisbeauftragten“ der Bezirksplankommission erarbeitet. Die Einhaltung der Festlegungen unterlag danach einer ständigen Kontrolle. Ich selbst war wenigstens ein Jahrzehnt lang für den Kreis Mühlhausen zuständig.
Wie jeder andere Mitarbeiter mußte ich diese Tätigkeit neben der eigentlichen Arbeitsaufgabe durchführen und hatte außerdem weitere Pflichten. Sie bestanden in der Betreuung wichtiger Baumaßnahmen sowie von mindestens einem Betrieb und einer Gemeinde. Nach mehrfachem Wechsel blieben mir in den letzten Dienstjahren (neben jeweils zwei bis drei Investitionsmaßnahmen) vor allem ein Arnstädter Betrieb und eine Grenzgemeinde im Kreis Eisenach, die für mich beide sehr interessant waren.
In Arnstadt gab es einen kleinen ehemaligen Privat-, später „halbstaatlichen“ und danach volkseigenen Betrieb. Ein engagierter Kaufmann hatte nach dem Krieg quasi „aus dem Nichts heraus“ einen florierenden Ersatzteilhandel auf- und ausgebaut. Bei der Übernahme in Volkseigentum war er ordnungsgemäß entschädigt worden - ein Insider nannte mir dafür mehr als eine Million Mark - und hatte sich als Betriebsdirektor zur Verfugung gestellt.
Nach Abbau der gegenseitigen Vorbehalte behandelte mich der ehemalige „Kapitalist“ zuvorkommend, zumal ich ihm nicht in seine Geschäfte hineinreden, sondern nur mit den Arbeitern über ihre eigenen Sorgen sowie aktuelle politische Probleme sprechen wollte. Bald wurden auch hier vor allem meine Versuche akzeptiert, bei der Lösung von inner- und außerbetrieblichen Problemen mitzuhelfen. Mit den innerbetrieblichen war das allerdings nicht immer einfach, denn der Betriebsleiter regierte sein vormaliges Imperium weitgehend nach eigenem Ermessen und mit eiserner Hand. Positiv äußerte sich dies in der unnachgiebigen Durchsetzung von Rentabilität, Arbeitsdisziplin und Ordnung. Nachteile konnte es allerdings jedem bringen, der beim Chef nachhaltig ins „Fettnäpfchen“ trat. Dies war zu spüren, wenn ich ihn in Auswertung meiner Gespräche über bestimmte Hinweise aus den Brigaden informierte. Aber letztlich galt für ihn die Arbeitsleistung. Dazu suchte er sich seine Leute aus, beförderte jeden „Blindgänger“ mit irgendeinem Dreh wieder hinaus - und hatte nie freie Stellen. Ganz im Gegenteil zu einem anderen volkseigenen Betrieb gleich gegenüber, auf den mich eine Brigade aufmerksam machte. Und obwohl mit der Strenge ihres Betriebsleiters nicht immer leicht zu leben war, hatten die Kollegen sie nicht gegen die großzügigeren Sitten der anderen Straßenseite eingetauscht, denn dort lag offenbar einiges im Argen. Die Kollegen nahmen u. a. Anstoß daran, daß sich die Betriebe rückfälliger Bummelanten sowie sonstiger Spezis nicht ohne viel Federlesens entledigen durften, weil es die Arbeitsgesetzgebung der DDR verbot. Vergeblich versuchte ich, deren großartige humanistische Prinzipien zu erläutern - man fand sie einfach „zu human“. Damit werde jeglicher Schlamperei Vorschub geleistet.
In diesem Arnstädter Betrieb wurde ich auch mit einer Erscheinung konfrontiert, die in der Endzeit der DDR generell überhandnahm: einer Art „Forderungsmentalität“. Der Zusammenhang zwischen der persönlichen bzw. volkswirtschaftlichen Leistungssteigerung und der Erfüllbarkeit neuer Forderungen war für viele Menschen nicht mehr erkennbar. Ich denke hier beispielsweise an ausufernde Diskussionen über die weitere Herabsetzung des Rentenalters, erinnere mich allerdings besonders einer netten Kollegin jenes Betriebes. Ihre Aufgabe war es, gewissenhaft kleine Schrauben in kleine Tüten zu zählen. Diese Arbeit wollte sie unverändert weiter tun. Aber nach ihrer Auffassung war sie einfach „mal dran“, wesentlich mehr Geld dafür zu bekommen. In derartigen Fällen ließ sich natürlich kaum helfen.
Dagegen konnte ich den Betriebsleiter bei dem einen oder anderen gerechtfertigten Anliegen unterstützen. (So, als die wichtige Versorgungsfunktion des Betriebes durch eine volkswirtschaftliche Umstrukturierung gefährdet war.) Wir respektierten einander, und irgendwann teilte der Millionär und ehemalige Kapitalist mir sogar im Vertrauen mit, daß er nur per Zufall kein „Genosse“ sei.
An die letzte „meiner“ Gemeinden, ihre Bürger und ihren Bürgermeister denke ich besonders gern zurück. Das schmucke Dörfchen mit schönen Fachwerkhäusern, einer alten Tanzlinde und wunderbaren Gärten lag unmittelbar an der Staatsgrenze zur BRD. Da die Bereitstellung von PKW für die Dienstfahrten der „einfachen“ Mitarbeiter des Rates des Bezirkes zunehmend schwieriger wurde, machte ich mich in der Regel frühmorgens per Bahn auf den Weg und gelangte nach mehrfachem Umsteigen schließlieh am späten Vormittag mit dem Bus dort an. Die letzten Fahrtkilometer waren besonders interessant, denn die Straße bildete einen „Schlauch“ durch das beiderseits liegende BRD-Territorium, bevor sie die letzte DDR-Siedlung erreichte. Man konnte allerdings auch ebenso gut von der „ersten“ sprechen, wie der Bürgermeister, ein ehemaliger Angehöriger der Grenztruppen, dies tat.
Er war zwar manchmal ein „Rauhbein“ und Dickschädel, wegen seiner unkonventionellen Herzlichkeit aber - ebenso wie seine Frau - für mich ein Glücksfall. Da er einer kleinen Gemeinde vorstand, erhielt er nur ein mäßiges Gehalt. Es war aber vor allem im Sinne der volkswirtschaftlichen Planerfüllung, wenn er im Garten Gemüse anbaute, Hühner hielt, einen Bullen mästete, Fallobst sammelte, sich in der LPG an der Tabakernte beteiligte oder auch mal für einen kranken Verwandten einsprang, der seine Gemüsejungpflanzen nicht selbst auf einem im Bezirk Suhl gelegenen Wochenmarkt anbieten konnte. Die letztgenannte Aktion brachte ihm allerdings einen Rüffel vom Rat des Kreises ein, da er nicht pflichtgemäß zur Begrüßung von Erich Honecker nach Eisenach geeilt war. Ich tröstete ihn damit, daß E. H. ein paar Tausend verkaufte Gemüsepflanzen wahrscheinlich lieber wären, als ein weiterer Jubilierer und sprach deshalb auch mit einem Funktionär des Kreises. Der sah das allerdings anders und warnte sogar - wohl in Erinnerung an andere Widerborstigkeiten - vor einem „schlimmen Ende“.
Tatsächlich engagierte sich mein Freund Bürgermeister in der Regel ausschließlich für das, was er einsah, womit er sich nicht lächerlich machte und seiner Gemeinde nutzen konnte. Wenn beispielsweise der Plan für das Zusatzaufkommen an Gemüse ausgerechnet Tomaten vorsah (welche nach seinen Erkenntnissen im örtlichen Klima nicht gediehen), ignorierte er diese Festlegung. Ich habe auch nie erlebt, daß er der LPG Pflanzenproduktion einen (an fernen Schreibtischen erarbeiteten und als zwingend proklamierten) agrotechnischen Termin aufzuzwingen versuchte.
Dagegen war er voller Eifer dabei, als ich ihn über einen zentralen Beschluß informierte, wonach das Gelände zwischen den Grenzzäunen unter bestimmten Sicherheitsvorkehrungen landwirtschaftlich genützt werden könne. Wir organisierten eine Besichtigung mit der LPG Tierproduktion und fanden tatsächlich - argwöhnisch beobachtet von einem Hubschrauber des BRD-Grenzschutzes - zwischen anmutigen Hügeln das ideale Gelände für eine Viehweide. Es dauerte einige Monate, bevor die Herde junger Bullen dort einziehen und sich den Sommer über ungestört mästen konnte. Besonders die von den DDR-Grenztruppen geforderte Höhe der Einzäunung hatte Schwierigkeiten bereitet. Zuletzt war alles vorschriftsmäßig - und trotzdem schaffte es beim Herbstabtrieb einer der Riesenkerle, mit hohem Satz in die „Freiheit“ zu springen. Genauer gesagt, zunächst den Bahndamm hinauf und dann die Gleise entlang in Richtung Westen. Mir verging das anfängliche Lachen, als ich diese Einzelheiten hörte. Denn es handelte sich um eine stark befahrene internationale Strecke. Aber es war nichts passiert, und in der ersten BRD-Gemeinde hatte man den unerwarteten Ankömmling als willkommenes Geschenk der „armen Brüder und Schwestern“ eingefangen.
Im Dorf war auch eine Grenzkompanie stationiert. Aber es gab, wie mir mein Bürgermeister berichtete, in seinem Territorium nie ernsthafte Zwischenfälle. Bis auf einen, dessen Opfer vor Jahrzehnten ein junges Mädchen aus dem Ort beim Beeren- oder Pilzesuchen geworden war - möglicherweise das erste überhaupt an der Staatsgrenze. Erschossen allerdings nicht von DDR-Grenzern, sondern vom Angehörigen einer westlichen Besatzungsmacht. Angeblich irrtümlich.
Über Alter und Geschichte der schönen kleinen Dorfkirche wußte mein Bürgermeister nichts zu sagen. Dafür erzählte mir seine Frau, daß er dort beim Dachdecken geholfen und dabei ein Bein gebrochen hatte. Eines schönen Tages brachte seine Tochter ihren Auserwählten nach Hause - einen Pfarrersohn und Bausoldaten, der nicht zum Studium zugelassen worden war und nun im Automobilwerk Eisenach arbeitete. Das paßte dem Vater zwar nicht recht - und ich konnte ihn verstehen -, aber er nahm es trotzdem gelassen und half dabei, dem jungen Paar im Dorf erst mal ein bescheidenes Nest einzurichten.
Was ich selbst in „meiner“ Gemeinde erreichte, kann ich nicht beurteilen. Gemessen an den Problemen des abgelegenen Grenzortes und seines Bürgermeisters wahrscheinlich nicht viel. Ich erinnere mich, daß ich nach bewährter Methode mein Diensttelefon, entsprechend viel Briefpapier und die Autorität meiner Vorgesetzten nutzte, um insbesondere die kontinuierliche Kohle- und Energieversorgung der Gemeinde zu sichern, aber auch das eine oder andere persönliche Anliegen ihrer Bürger zu erfüllen. Und vom Bürgermeister wußte ich, daß er vor allem jemandem sein Herz ausschütten wollte. Wir verstanden uns gut. Einmal war ich an meinem Geburtstag dort. Er erfuhr es und holte aus irgendeinem Winkel ein Riesenbüschel prächtiger Veilchen, die sich danach auf sämtlichen Beeten meines Gartens ansiedelten und sicher auch im kommenden Frühjahr blühen werden.
Sofern die Fahrbereitschaft des Rates des Bezirkes mir keinen PKW genehmigt hatte, mußte ich die abendlichen Gemeinderatssitzungen verlassen, wenn der letzte Bus vor der Tür stand. Auf dem Erfurter Hauptbahnhof kam ich dann nach Mitternacht an. Diese Einsätze waren natürlich strapaziös - besonders für eine Frau nahe Sechzig -, doch sie waren es mir wert.
Übrigens, so hörte ich später, hat mein Bürgermeister - er ist ein Fußballnarr - nach der Grenzöffnung als erstes ein Spiel gegen das BRD-Nachbardorf organisiert. Die Bürger seiner Gemeinde wählten ihn erneut. Und da der Dickschädel nicht aus der Partei austrat, wurde er damals einer der wenigen PDS-Bürgermeister im Lande Thüringen. Im Kreis Eisenach, so viel ich weiß, der einzige. Inzwischen ist er längst in Rente und leider auch krank. Aber er bleibt einer der Menschen, die ich nie vergessen werde.
Selbstverständlich stellten sich die Funktionäre von Kreisen, Städten und Gemeinden in vielen Aussprachen und Veranstaltungen jederzeit - und nicht nur vor Wahlen - den Fragen und Problemen der Bevölkerung. Aber die sogenannte „Öffentlichkeitsarbeit“ des Rates des Bezirkes sowie weiterer auf Bezirksebene angesiedelten Organe gipfelte im allmonatlichen Großeinsatz des „Bezirksreferentenkollektivs“ in sämtlichen Städten und Gemeinden eines unserer Kreise. Die Referenten waren leitende oder anderweitig profilierte und rhetorisch begabte Funktionäre. Ich besaß keine dieser Voraussetzungen, mußte jedoch oft als Hilfskraft einspringen. Denn diese Aufgabe wurde sehr gründlich angepackt - tagsüber beginnend mit Ortsbegehungen und Aussprachen in Betrieben, LPG, Handelseinrichtungen, mit Einzelpersonen, Stadt- bzw. Gemeinderat, Vertretern der Nationalen Front, von Parteien, Massenorganisationen usw. bis hin zur Durchführung einer öffentlichen Sprechstunde und der abendlichen Einwohnerversammlung. In ihr versuchte der Referent, unter Berücksichtigung der örtlichen Gegebenheiten die jeweiligen politischen oder ökonomischen Schwerpunkte zu erläutern und auf Fragen der Bürger einzugehen. Im Laufe des Tages kam da natürlich viel zusammen an Hinweisen, Kritiken und Beschwerden, die danach vom Gehilfen des Referenten zusammengefaßt, ausgewertet, bearbeitet, zur Entscheidung vorgelegt und termingemäß beantwortet sein wollten. Was im Sinne einer „mündlichen Eingabe“ gemeint und deshalb wie jede schriftliche zu registrieren war, unterlag strengsten Maßstäben. Die Inhalte sowie Bearbeitungsdaten wurden statistisch erfaßt und vom Rat kontrolliert. Über kein anderes Thema erhielten wir so häufig Belehrungen, wie über den Umgang mit Eingaben. Den verantwortlichen Leitern konnte kaum Schlimmeres passieren, als vom Rat in dieser Hinsicht kritisiert zu werden. Grundsätzlich galt sogar, daß jede Antwort „vor Ort“, d. h. durch Aufsuchen des Beschwerdeführers zu erfolgen hatte.
Selbstverständlich passierte es - und dies betraf vor allem Baumaßnahmen -, daß nicht jeder Wunsch sofort erfüllt werden konnte. Manchmal kam derselbe oder ein anderer Bezirksreferent beim nächsten Mal in den gleichen Ort, fand die Straße in schlimmerem Zustand als ein Jahr zuvor oder die geforderte neue Schule noch immer nicht in Aussicht. Vielleicht war aber inzwischen im Nachbarort gebaut worden, denn für die meisten Bereiche existierte eine (nach gewissenhafter Prüfung von den kreislichen bzw. bezirklichen Organen bestätigte) langfristige „Rang- und Reihenfolge“ der Baumaßnahmen. Natürlich versuchte mancher Bürgermeister, diese zugunsten seiner Gemeinde noch zu kippen und dafür auch den Erfurter Referenten einzuspannen. Meist blieb das erfolglos, weil der Gast sich an die Spielregeln zu halten und die Entscheidung letztendlich doch den zuständigen Organen zu überlassen hatte. „Geschenke“ und Versprechungen waren untersagt. Nur die allerhöchsten Funktionäre handelten nach eigenem Ermessen und betätigten sich manchmal als „Weihnachtsmann“. (Obwohl dieser natürlich niemandem unbesehen etwas wegnehmen würde, um es anderen zu schenken. Denn genau dies war die allgemein bekannte Kehrseite der freundlichen Spenden.)
Meine eigentlichen dienstlichen Aufgaben waren hauptsächlich mit der bezirklichen Baubilanz sowie eine Zeitlang mit den Eigeninvestitionen des zentralgeleiteten Bauwesens verknüpft. (U. a. war ich jahrelang als Beauftragte der Bezirksplankommission für den Aufbau des VEB Eichsfelder Zementwerke Deuna eingesetzt.) Es würde den Rahmen sprengen, näher auf die mehr als komplizierte Problematik der Baubilanzen oder des Baugeschehens einzugehen. Deshalb beschränke ich mich auf wenige Beispiele aus meiner Arbeit.
Da ich in der Bezirksplankommission
mehr als ein Jahrzehnt lang für die Industriebaubilanz verantwortlich
zeichnete, war mein wichtigster Partner das zuständige Bilanzorgan VE Bau- und
Montagekombinat Erfurt. Als „Chefbilanzierer" amtierte dort ein
parteiloser Kollege. Er stammte von der Insel Rügen und entsprach in Charakter
und Auftreten ziemlich genau dem Bild, das man sich von diesem Menschenschlag
macht. Was auch sagen will: Nachdem er sich von meinen redlichen Absichten überzeugt
hatte, versuchte er, mich geduldig und sachlich in die Mysterien seiner Arbeit
einzuführen. Es dauerte länger als ein Jahr, bis ich - auch dank anderer
Kollegen - das Wesentlichste begriffen hatte. Eines unserer gemeinsamen Ziele
bestand danach darin, die Dringlichkeit der Vorhaben, den Vorbereitungstand und
die technologisch günstigsten Bauabläufe einigermaßen unter den Hut der
Industriebaubilanz zu bringen. Trotzdem galt das Interesse des Baukombinates natürlich
in erster Linie der eigenen Ökonomie. Und wenn es darauf ankam, saß es am längeren
Hebel. Man brauchte nur ein unattraktives Vorhaben aus „Kapazitätsgründen“
nicht in die betriebliche Projektierungsbilanz aufzunehmen - und bevor es jemand
richtig merkte, waren die gesetzlichen Termine für die Vorbereitung nicht mehr
zu schaffen. Die Baumaßnahme flog in der Bilanzabstimmung beim Ministerium für
Bauwesen, spätestens aber in der Komplexberatung des Bezirkes aus dem
Planentwurf, die vorgesehene Baukennziffer wurde gestrichen.

Palast der Republik: Haus des Volkes und Sitz der Volkskammer, errichtet von Bauarbeitern aus allen Bezirken der DDR. Blick aus dem Rohbau zum Berliner Fernsehturm
Ich sah ein, daß die von den wirtschaftsleitenden Organen oft nach dem „Gießkannenprinzip“ ausgeschütteten Kennziffern für das Bauwesen teilweise inakzeptabel waren. Deshalb konzentrierten wir uns während mehrerer schwieriger Vorabstimmungen mit den Industrieministerien gemeinsam darauf, die Kennziffern den technologischen Erfordernissen anzupassen, und nicht umgekehrt. Dieses Herangehen erschien mir schlicht logisch, und ich war erstaunt, als das Ministerium für Bauwesen daraus flugs das „Erfurter Beispiel“ machte. Einige Beteiligte, darunter auch mein Abteilungsleiter und ich, erhielten in diesem Zusammenhang vom Rat des Bezirkes die Verdienstmedaille der DDR. Der stellvertretende Kombinatsdirektor - ein beispiellos fleißiger, vielgeplagter und trotzdem stets freundlicher Genosse - wurde vom Rat ebenfalls damit ausgezeichnet, bekam die gleiche Medaille jedoch einige Tage später auch vom Ministerium für Bauwesen. Als ich ihn deswegen ansprach, meinte er: „Macht nichts, ich arbeite schließlich auch mindestens für zwei!“ Wo er recht hatte, hatte er recht. Des Rätsels Lösung war, daß die Verleihung der Verdienstmedaille (zumindest in dieser „Runde“) von keiner Stelle koordiniert wurde. Jeder Verantwortungsbereich verfügte über ein eigenes Kontingent. Meines Wissens blieb diese doppelte staatliche Auszeichnung für jenen tüchtigen und beliebten Genossen allerdings auch die letzte, denn wir mußten ihn leider bald zu Grabe tragen.
Andere haben es anders erlebt: Aber an schwerwiegende Eingriffe der zentralen Organe in das laufende Plangeschehen kann ich mich für mein spezielles Arbeitsgebiet kaum erinnern. Eine Ausnahme bildete die republiksweite Aktion zur Umstellung ölbetriebener Heizungsanlagen auf feste Brennstoffe. Die Situation auf dem Weltmarkt schien damals keine andere Alternative zu erlauben. Da wurde natürlich alles durcheinandergewirbelt, insgesamt entstanden ökonomische Verluste, und auch die Umweltschützer gerieten unter Druck. Ich fand es trotzdem beeindruckend, wie anfangs unmöglich Scheinendes in allen Ebenen angepackt und in kürzester Frist realisiert wurde.
In einer nicht ganz so ruckartigen, aber ebenfalls erfolgreichen und diesmal auch der Umwelt zuträglichen Aktion wurden eine Menge Wirtschaftstransporte „von der Straße auf die Schiene“ verlegt oder so weit optimiert, daß sie sich generell reduzierten. Damit verbunden war die Festlegung, die Grundversorgung der Bevölkerung in der Regel aus den jeweiligen Territorien zu sichern. Natürlich gab es vor allem anfangs Pannen, aber die Linie war goldrichtig: Genauso stellte und stelle ich mir die Maßnahmen einer sozialistischen Planwirtschaft vor, die dem kapitalistischen Wirtschaftssystem überlegen und für die Zukunft der Menschheit unerläßlich ist.
Die Theorie der Planung und Leitung einer sozialistischen Volkswirtschaft muß natürlich anhand unserer Erfahrungen neu überdacht werden. Das gleiche trifft für die Arbeitsweise des Staatsapparates und die Entwicklung der sozialistischen Demokratie zu. Trotzdem sind unsere Defizite nach meiner Auffassung keineswegs in den durch die DDR-Verfassung sowie andere wichtige Gesetze festgelegten Inhalten und Strukturen begründet, sondern vielmehr darin, daß wir diese in der Praxis nicht genügend mit Leben erfüllt oder ihnen sogar zuwidergehandelt haben. Das gilt übrigens auch für das Statut der SED.
Allerdings darf bei keiner ernstzunehmenden Analyse außer Acht gelassen werden, daß unser erstes Sozialismusexperiment während des Kalten Krieges stattfinden mußte. Und trotz der eigenen Verantwortung für sein Scheitern sollten wir jedem entgegentreten, der sämtliche Verformungen aus dem Wesen der sozialistischen Gesellschaftsordnung ableiten will. Denn bei neutralem Verhalten oder gar Unterstützung unserer feindlichen „Brüder und Schwestern“ hätte kein ehrlicher Genosse den frischen Wind in Partei, Staat und Gesellschaft gescheut und die „Mauer“ wäre nicht gebaut worden. Wer diese historischen Umstände „übersieht“, ist entweder ein Heuchler oder mehr als naiv.
Die letzten Jahre der DDR haben wahrscheinlich alle ähnlich erlebt. Es gab wachsende Schwierigkeiten, doch sie wurden in nie dagewesener Weise beschönigt und unter den Tisch gekehrt. Erwischen lassen durfte sich keiner, aber die ertappten Sünder waren meist nicht die wirklich Schuldigen. Bei uns kam eine Veränderung des Arbeitsklimas hinzu. Zwischen den „einfachen“ Mitarbeitern war es unverändert gut. Aber unmerklich hatte sich eingeschlichen, was mir zu schaffen machte: die spürbar wachsende Arroganz und Kritikempfindlichkeit der Leiter. Mancher Vorgesetzte sprach von „seinem Apparat“ und meinte das auch so. Die Mitarbeiter hatten Weisungen zu empfangen und reibungslos zu funktionieren. Bei meinem Chef war das scheinbar anders - der hörte zu und ließ sich selbst auf kritische Diskussionen ein, bevor er uns in die Schranken wies. Dennoch überraschte er gelegentlich ebenfalls durch erstaunliche Geisteshaltungen. So, als ich nach Jahren enger Zusammenarbeit erstaunt konstatierte, daß uns die „Alma mater Lipsiensis“5 wohl zu gleicher Zeit in ihren Armen gehalten haben müsse (als Studenten und Studentin der gleichen Fakultät, mich aber außerdem als gewähltes Mitglied des Studentenrates sowie der zentralen FDJ-Leitung). Denn da kam nicht nur heraus, daß er dies seit meiner Einstellung wußte, sondern er bemerkte mit sichtlicher Genugtuung: „Damals war ich ganz unten und du ganz oben, und heute ist es eben umgekehrt.“ Unten - oben: Solche Weltsicht machte mich sprachlos. Was ein Fehler war, wie ich heute weiß.
Aus eigenem Erleben möchte ich hier nicht weiter berichten. Denn Kämpfe, die ich damals nicht ausgefochten habe, verbieten sich im Nachhinein. Aber ich muß bei diesem Thema an einen der letzten „ganz alten“ Genossen unserer Dienststelle denken, der - nach Jahrzehnten beträchtlicher Verantwortung - nun eine etwas leichtere Aufgabe übernommen hatte. Eines Tages beklagte er sich bei mir bitter darüber, daß einer der Chefs, selbst hinter seinem Schreibtisch thronend, ihn als dummen Jungen behandelt und nicht einmal zum Sitzen aufgefordert hatte. Und dies, obwohl der Parteiveteran ihm Jahrzehnte zuvor in der ANTIFA-Jugend erst das politische ABC beigebracht hatte.
Ehrlich gesagt, reagierte ich gegenüber Jüngeren und Gleichaltrigen insgeheim auch ziemlich sensibel. Vielleicht muß man es unserer Generation ein wenig nachsehen, wenn sie gegenüber den bewährten Antifaschisten nicht genug Mut zur Kritik aufgebracht hat. Aber in der letzten, entscheidenden Zeit waren diese nur noch in den höchsten Partei- und Staatsfunktionen zu finden. Die da überall in Amt und Würden nachrückten, sich zunehmend autoritär gebärdeten und durch ihre Kritikfeindlichkeit maßgeblich zur überhandnehmenden Erstarrung des innerparteilichen und gesellschaftlichen Lebens beitrugen, waren meine Altersgefährten oder noch Jüngere. Es ist unverzeihlich, daß wir anderen ihnen dies haben durchgehen lassen. Daran ändert auch die Tatsache nichts, daß es sich in der Regel um sehr befähigte und einsatzbereite Genossen handelte, die ihre Kräfte nicht schonten.
Im Wissen um die innere Haltung einiger Funktionäre nahm ich zunehmend selbst an Erscheinungen Anstoß, für die ich normalerweise nur ein Achselzucken oder sogar Verständnis übriggehabt hatte. Es ging dabei keineswegs um unmittelbare „persönliche Vorteilnahme“ - in dieser Hinsicht existierten auch für unsere Leiter strenge Regeln - sondern eher um ein verschleiertes Bemühen, sich allmählich vom „Fußvolk“ abzugrenzen und Ausnahmebedingungen zu schaffen. Gemessen an dem heute Üblichen waren es weniger als Nichtigkeiten, und im einzelnen ließ sich auch alles begründen. Aber in der Summe stimmte es für meine damalige Empfindung nicht mehr. Da wurde mit beträchtlichem Aufwand in der Chefetage des Hochhauses („wegen der Besucher“) eine Klimaanlage installiert, während viele der übrigen Mitarbeiter, je nach Jahreszeit, weiter frösteln oder schwitzen durften. „Sparbeschlüsse“, z. B. für PKW-Fahrten, zeigten stets nur eine Zeitlang Wirkung. Sie wurden zuerst von Leitern durchbrochen, die auf die strikte Disziplin aller Mitarbeiter achteten - getreu dem Motto: „Wenn zwei dasselbe tun, ist es nicht dasselbe“.
Trotzdem gab es auch Lichtblicke. Mein Chef fuhr eine Zeitlang tatsachlich mit der Straßenbahn zur Arbeit und auch mal mit dem Zug nach Berlin. Ein älterer „Ratsherr“ weigerte sich über Jahre, im gesonderten Speisesaal zu dinieren und setzte sich lieber zu den Mitarbeitern. Ein anderer stellte sich regelmäßig an die Spitze der Ernteeinsätze und beschämte manchen „unabkömmlichen“ jüngeren Funktionär. (Übrigens habe ich selbst im Laufe der Jahre wie alle meine Kollegen jede Menge Kirschen, Äpfel, Erdbeeren, Gurken, Zwiebeln, Rüben und Kartoffeln von Bäumen und Feldern geholt.)
Ganz zuletzt konnte dann wohl niemand mehr die Augen vor der kritischer werdenden Situation verschließen, während die Bereitschaft der Partei- und Staatsfunktionäre, sich offen den Problemen zu stellen, rapide abnahm. Zumindest in den größeren Parteiversammlungen geriet der Meinungsaustausch immer öfter zur Farce. Beispielsweise war die parteiliche Kritik an anderen Fachbereichen, z. B. auf Delegiertenkonferenzen, verpönt. Und auch ich unterrichtete zwar im Auftrag unserer Parteigruppe, wie das gefordert wurde, die übergeordneten Parteileitungen monatlich schriftlich über „Probleme, Stimmungen und Meinungen der Bevölkerung“, stellte sogar Fragen. Aber eine Antwort erhielten wir in keinem Fall - selbst nicht auf unsere wiederholten Kritiken an dieser unverständlichen Praxis.
Inzwischen wurde die Planerfüllung ständig problematischer. Änderungen waren zwar offiziell nicht gestattet, aber am Jahresende sah jeder Plan trotzdem anders aus als am Anfang. (Die Ursachen waren sowohl objektiver als auch subjektiver Natur, aber bereits aus meiner eingeschränkten Sicht derart vielgestaltig, daß ich in diesem Rahmen nicht auf sie eingehen kann.) Die zentralen Beschlüsse überschlugen sich auch auf dem Gebiet des Baugeschehens und standen oft gegeneinander, d. h. in ihrer Summe überschritten sie die Möglichkeiten. Wer für seinen Bereich mit einem zentralen Beschluß wedelte, wonach dies und jenes unbedingt zu sichern sei, mußte nicht selten diese ernüchternde Tatsache zur Kenntnis nehmen. Nun wurde auch von der Bezirksplankommission erwartet, manche Erfüllungs- und Lageberichte für die höhere Leitungsebene zu filtern, d. h. „schönzuschreiben“. Ich selbst konnte mich dieser Aufgabe durch Verzicht auf eine besser bezahlte Planstelle entziehen - ohne allerdings offene Kritik an Zuständen zu üben, die von den meisten Mitarbeitern kopfschüttelnd abgelehnt wurden. Wir murrten, wollten selbst unbedingt ehrlich bleiben, schrieben Realitäten auf und gaben sie weiter. Was man ein paar Stockwerke höher daraus machte, erfuhren wir - wenn überhaupt - erst später.
Ich schluckte also Ärger und Besorgnis über solche wie weitere Erscheinungen nur allzuoft hinunter und übte mich in „freiwilliger Disziplin“. Weshalb? Natürlich, wie die meisten anderen, auch infolge fehlender Zivilcourage oder aus Bequemlichkeit bzw. Anpassung. Aber im Kern war es die verbreitete „Festungsmentalität“: Wer, so lange der Feind vor den Toren stand, den Aufstand übte (oder seine „politische Notdurft“ verrichtete, wie Inge v. Wangenheim dies nannte), würde die Festung sturmreif machen. Deshalb verband auch ich mit Gorbatschow anfänglich große Hoffnungen. Nach dem Vorbild und an der Seite der Sowjetunion konnte, mußte eine durchgreifende Veränderung gelingen. Damals diskutierten wir stundenlang in den Parteigruppen. Ich vertrat die Meinung - und denke, es war richtig -, daß die Erneuerung der gesellschaftlichen Verhältnisse in der Partei beginnen und von ihr ausstrahlen müsse.
Irgendwann war ich dann in Leipzig und suchte mit meinem Mann die Wohngegend auf, in der wir vierzig Jahre zuvor gewohnt und geheiratet hatten. Obwohl es auch in Erfurt trotz „vorrangiger Bilanzierung“ mit den Baureparaturen nicht recht klappen wollte, standen wir beide erschüttert vor dem Ausmaß des Verfalls in jenem Leipziger Stadtteil. Dafür gab es keine Entschuldigung, das war einfach eine Schande. Ich fühlte mich mitverantwortlich, und mir war nie zuvor oder danach klarer, daß Wirtschafts- und Planungsmethoden, die derartige Ergebnisse zeitigten, gründlicher Änderung bedurften. An fehlenden Hinweisen und Vorschlägen gegenüber den zentralen Organen konnte es nicht liegen. Eigentlich auch nicht an gesetzlichen Änderungen, aber alle kamen verspätet oder trafen nicht den Kern. Natürlich war es äußerst schwierig; immerhin mußten alle volkswirtschaftlichen Belange gegeneinander abgewogen werden. Doch nicht nur in einem Fall hatten die örtlichen Organe jahrelang drängen müssen, bevor die Zentrale reagierte.
Als der erste große Erfurter Lichterzug an unserem Haus vorbeizog, rannte ich hinterher, landete inmitten Zehntausender auf dem Domplatz und erlebte, wie die Oberbürgermeisterin - eine kämpferische und treusorgende „Stadtmutter“ - niedergebrüllt und ausgepfiffen wurde. Mit einigen sachlichen Rednern konnte ich mich fast identifizieren, andere stießen nur Schmähungen aus. Damals und später hoffte ich noch auf die Kraft der Partei, brannte darauf, mit Hunderttausenden ehrlicher Genossen ebenfalls auf die Straße zu gehen. Nicht unter den alten Losungen, aber doch unter anderen als dem verhängnisvollen „Wir sind ein Volk“. Mir kam bei alledem der 17. Juni 1953 nicht aus dem Sinn. Hatten wir denn gar nichts gelernt? Aber die übergeordneten Leitungen schwiegen sich aus.
Im Zusammenhang mit dem 40. Jahrestag der DDR wurden in Stadt und Land Zehntausenden „Gründern“ Erinnerungsmedaillen überreicht. Es war bekannt, daß an diesem Abend eine weitere Protestkundgebung auf dem Domplatz stattfinden sollte. Ich hatte einem Mitarbeiter der Bezirksleitung vorgeschlagen, die Festveranstaltungen abzusagen und alle Erfurter Genossen sinnvoller einzusetzen. Nachdem er dies angeblich mit seinem obersten Chef besprochen hatte, kam die telefonische Antwort: „Keine Sorge. Er hat alles im Griff.“ Also nahm auch ich brav meine Plakette zum 40. Geburtstag der DDR entgegen, während ein paar Hundert Meter weiter emsig an ihrem Grab geschaufelt wurde.
Als ich dann am 9. November 1989 die Fernsehübertragung vom Alexanderplatz sah, hatte ich das Gefühl, mein Haar würde weiß. Denn was diesem Tag folgen würde, war abzusehen.
Mit der Schilderung einiger meiner Erlebnisse wollte ich einen Eindruck vom Alltag der Mitarbeiter des Staatsapparates der DDR vermitteln. Es waren viele Tausende, die über Jahrzehnte mit Engagement und Beharrlichkeit den vielfältigsten Problemen zu Leibe rückten und unter schwierigen Bedingungen (besonders in den unteren Ebenen) das Beste für die Bürger der DDR zu tun versuchten. Wer sich dieser Aufgabe stellte, konnte davon weder Privilegien noch ein Riesengehalt erhoffen und hätte entsprechend seiner Qualifikation und Erfahrung in anderen volkswirtschaftlichen Bereichen meist wesentlich mehr verdient. Aber nicht genug damit, daß nach 1989 unser Lebenswerk und das vieler Millionen ehrlicher Menschen, die sozialistische DDR, bespien und vernichtet wurde, waren und sind wir noch immer von einem willkürlichen Rentenstrafrecht betroffen, das im eklatanten Widerspruch zum Grundgesetz steht. Bei der Beurteilung von Verfassungstext und -Wirklichkeit der BRD sollte dieses schmähliche Kapitel der „Nachwendegeschichte“ nicht vergessen werden.
Abschließend meine Lebensbilanz: Ich habe gemeinsam mit meinem Mann vier gute Kinder großgezogen und mit der verbleibenden Kraft einem Staat gedient, der nicht nur ihnen, sondern - trotz läßlicher und schwerer menschlicher Fehler - allen seinen Bürgern unter den schwierigsten internationalen Bedingungen eine sichere und vor allem friedliche Perspektive bot.
Das ist, denke ich, trotz allem nicht wenig.
Ursula Münch
1 Wir haben einen Plan gemacht - Anfang eines bekannten FDJ-Liedes aus den ersten Jahren der DDR
2 Allerdings noch ohne Diplom, da meine Fachrichtungen (Außenpolitik bzw. Kultur) an der Universität Leipzig kurz zuvor aufgelöst worden waren und mein Mann versetzt wurde. Von Erfurt aus nahm ich aber ein Fernstudium auf, das ich im Sommer 1954 als Diplomwirtschaftlerin abschloß. Dies wurde auch durch die Hilfe einer selbstlosen Oma ermöglicht, die sich im Notfall unserer beiden Ältesten annahm.
3 In den meisten „materiellen und nichtmateriellen“ Bereichen existierten zentral-, bezirks- und kreisgeleitete Betriebe und Einrichtungen mit den entsprechenden Entscheidungsebenen, wobei die Abstimmung und Kontrolle der Gesamtentwicklung im Territorium dem Rat des Bezirkes in Verbindung mit den o g Ebenen oblag.
4 Nach meiner Erinnerung unterstand damals z. B. die Bezirksplankommission dem Vorsitzenden des Wirtschaftsrates. Später wurden beide Aufgabenbereiche wieder getrennt.
5 Leipziger Universität